…
Der frühe Herbst war so richtig günstig für die Pilzsuche, denn diese Waldfrüchte waren Onkels Leib- und Magenspeise. Er ging gern spazieren, um die leckeren Früchte des Harzer Bergwaldes zu ergattern, die zu allem Überfluss auch noch kostenlos auf den Tisch des Hauses Geries purzelten.
Eines Morgens berichtete Papa beim Frühstück, dass der ganze Garten voller Hirsch- oder Rehspuren sei. Das war eigentlich nichts Außergewöhnliches, weil wir nahe am Wald wohnten. Trotzdem eilten sofort alle hinaus, um das Ereignis nachzuprüfen. Es stimmte: Ein Hirsch oder ein Reh hatte unserem Garten einen Besuch abgestattet.
Am Morgen darauf war Tante Ludmilla die erste, die in den Garten ging, um nachzuschauen, ob da etwa wieder Hirsch- oder Rehspuren zu entdecken wären. Sie war kaum unten angekommen, als wir oben in der Wohnung ihren Schreckensschrei vernahmen: „Ottooo! Det kann ja woll nie wahr sin!“
Papa, Onkel Otto und ich rasten hinunter in den Hoffmeisterschen Garten und fanden die Tante schreckensbleich an der Wand lehnen.
Sie stammelte nur: „Da, da!“ und wies mit dem ausgestreckten Finger auf den nahen Waldrand. Alle Augen richteten sich nun auf die angegebene Stelle. Wir sahen gerade noch, wie sich das Unterholz hinter dem gewaltigen Hinterteil eines ebenso gewaltigen Hirsches schloss.
Der ganze Garten war voller Spuren dieses Hirsches. Sogar einige Blumen hatten dran glauben müssen. Sie waren aber nicht zertrampelt worden, sondern hatten offenbar als Magen-füllung des Waldbewohners herhalten müssen, wie die frisch gekappten Stängel vieler Margeriten bewiesen. Margeriten, Lupinen und Winterastern schienen die Leibspeise der Hirsche in den Braunlager Wäldern zu sein.
Onkel Otto wollte gleich auf Fotojagd gehen. Aber dazu war Tante Ludmilla nicht zu bewegen. Sie war eben doch ein eher ängstlicher Typ. Mit Onkel Ottos Worten gesprochen war sie „ebend doch bloß a ne Frau, die zwar allet wissen und sehen will, aba dann im entscheidenden Moment kneift.“
Diese respektlose Äußerung trug ihm sofort einen strafenden Blick von Mutter und von Tante Ludmilla ein und den dezenten Hinweis, dass er ja auch nicht viel tüchtigerer sei als sie. Sonst hätte er ja längst einmal einen besseren Beruf ausüben können, als „nur Handlanger uff’m Bau zu sein.“
„Nimm da man amol a Beispiel am Maxe, der is‘ ieberoll daheeme uff da Arboit. Sunst würd’n sein Chef ja och nie a su guttt bezohle“, endete die Tante in vollendetem Berlinerisch mit schlesischem Einschlag und ließ uns alle stehen, um sich in Ruhe dem Rest des kulinarischen Frühstücks zu widmen.
Essen war nun einmal eine ihrer Hauptleidenschaften.
Oma allerdings stand immer noch fassungslos vor den Blumenbeeten und jammerte: „Och nee, och nee! Die schiena Bliemla!“
Auf allen unseren Beeten standen die Blumenstängel zwar noch, aber die Blüten waren exakt am oberen Ende des Stiels abgezwickt worden. Dieser Zerstörungsakt war mit vollkommener Präzision vollzogen worden.
„Dos Beest hot olle Bliemla gefressa, diesa verdommte Saukerle!“, schimpfte Oma weiter, als wir wieder nach oben gingen und versuchten, sie zu trösten.
Vor allem Tante Ludmilla konnte sich wegen des Hirsches gar nicht beruhigen.
Über das Verhalten eines Hirsches konnte sie ja als Stadtmensch nicht viel wissen. Und so war ihre Neugierde sehr verständlich.
Aber auch uns wunderte es, dass alle Blumen abgefressen worden waren – bis auf die Rosen. Vielleicht war dieser Hirsch etwas Besonderes, wie zum Beispiel ein Feinschmecker des Waldes. Mochten Gourmets im Tierreich vielleicht keine Rosen? Oder hatte er nur etwas gegen Dornen und die damit verbundenen Verletzungen im Maul?
So kreisten meine Gedanken immer wieder um den Hirsch. Und ich war nicht der Einzige, dem solche Gedanken keine Ruhe ließen. Bei Tante Ludmilla drehte sich das ganze Frühstücksgespräch nur noch um den Herrn des Waldes und seine feinschmeckerischen Vorlieben.
Und es war dann auch Tante Ludmilla, die schließlich sagte: „Na ja, alle scheen und guttt, jeseh’n ham wa dat Viech ja nu och, jefress’n hat a ja och jede Menge, aba wie schreit‘ n so ’n Biest eechentlich?“
„Das ist ganz einfach,“ erklärte Papa. „Die Hirsche schreien nicht, sondern die röhren, wie der Jäger so sagt. Das klingt dann so ähnlich, als ob du in eine leere Blechröhre pustest.“
„Dat wird‘ ick ja jerne mal heer’n“, verkündete Tante.
„Du bist ja verrickt, Weib“, lautete Onkel Otto ironischer Kommentar. „Diese Viecha schrei’n ja woll nie uff Befehl, wa? Die sind ja woll a nie so bleed wie du oder ich.“
So flachsten wir noch eine Weile weiter und verlängerten da-durch unser Frühstück um eine weitere halbe Stunde. Wenn wir allein waren, ging alles schneller.
Nur dieses Mal war ich gar nicht so böse darüber, denn da konnte ich in Ruhe meinen sehr eigenen Hirsch-Gedanken nachgehen.
Gerade, als Papa erzählte, dass die Hirsche vorwiegend in den frühen Morgenstunden oder kurz nach Mitternacht schreien würden, hatte sich ein Gedanke in meinem Kopf festgesetzt, der mich den ganzen Tag nicht mehr los ließ.
Der Tag verging wie im Fluge.
Der Abend kam, das Abendessen ging zu Ende und wieder war unser einziges Gesprächsthema der Hirsch und sein Brunftschrei.
Dann wurde es endlich Nacht und nach einigen Bieren und ein paar Schnäpsen hatten die Erwachsenen bald die nötige Bettschwere.
Onkel und Tante gingen als erste schlafen.
Ich war auch schon längst im Bett. Aber ich wollte nicht einschlafen, sondern traf Vorbereitungen und hatte den Wecker gestellt, für den Fall, dass mich der Schlaf doch über-mannen sollte. Schließlich hatte ich in Gedanken – so quasi per Instant-Telepathie – ein Übereinkommen mit diesem Blu-men fressenden Hirsch getroffen. Der sollte in dieser Nacht für meine Tante Ludmilla Melcher aus Berlin-Tegel schreien. Ganz ordentlich und exklusiv nur für sie und Onkel Otto, versteht sich.
Bloß die Tante durfte natürlich von diesem Röhr-Vertrag nichts wissen. Schließlich unterliegen Verträge zwischen kleinen Menschen und Hirschen immer der äußersten Geheimhaltungsstufe.
Unruhig wartete ich bis Mitternacht, denn zur Geisterstunde musste das Brüllen oder Röhren eines bestellten Hirsches sicher noch besser wirken. Tante und Onkel schienen wohl schon zu schlafen, denn als ich an der Schlafzimmertür lauschte, hörte ich Onkel Ottos regelmäßige, tiefe Schnarchtöne, die immer so begannen, als wollte eine Dampflokomotive anfahren. Zum Schluss gab es fast jedes Mal einen schrillen Pfiff, dass ich dachte, der Schaffner hätte in seine Trillerpfeife geniest oder seine Trillerpfeife mit dem Dampfdruck des Lokomotivkessels betrieben.
Ich platzte fast vor Neugierde, wie sich die beiden verhalten würden, wenn sie den „Hirsch“ hörten.
Gerade, als der „Hirsch“ das erste Mal etwas leise und vor-sichtig röhrte, denn er musste ja noch üben für den zweiten Schrei dieser Nacht (da fallen die ersten immer etwas kläglich aus!), stöhnte Tante plötzlich leise im Schlaf auf. Ich musste auch etwas Rücksicht nehmen, denn schließlich waren die Nachbarn nicht eingeplant. Die sollten zum einen nicht gestört werden, zum anderen kannten die eventuell den Trick schon. Also trötete ich so leise, dass es nicht gerade ein markzerreißender Brunftschrei wurde.
Onkel schnarchte mit unverminderter Härte weiter und schien alle Bäume des Harzes in einer Nacht absägen zu wollen. Tante Ludmillas Atemgeräusche waren auch wieder ganz regelmäßig zu hören.
Doch dann kam der zweite Brunftschrei dieses riesigen Wald-bewohners und Tantchen fiel wohl vor Schreck fast aus dem Bett. Jedenfalls brachen Onkels Schnarchen und die Atemgeräusche der Tante abrupt ab. Stattdessen hörte ich Fußgetrappel und flüchtete schnell hinter einen Busch im Garten, um nicht gesehen zu werden. Jetzt war Tante Ludmilla mit einem Mal hellwach und erschien am Fenster.
„OOOttoooohhh!“, lang gezogen hallte ihr Schreckensschrei durch das dunkle Schlafzimmer meiner Eltern. „OOOttooo! Och neeee! Och neeee! Dat Viech is‘ hiaaa!“
„Wo denn? Wat denn? Du träumst ja ock bloß“, brummte Onkel Otto und wollte einfach wieder weiterschlafen. Da riss ihn der mächtigste Brunftschrei des größten Platzhirsches des Harzes endlich doch aus seinen wonnigsten Bier- und Essens-träumen.
„Wo? Wat? Wieso?“, schnaufte er, stemmte sich aus dem Bett und eilte im Schlafanzug ans Fenster. Auch unten im Wohn-zimmer wurde das Fenster von meinem Eltern besetzt und die Vorhänge zur Seite gezogen.
„Ich seh‘ nichts!“, tönte laut Mutters Stimme.
„Freilich nicht!“, rief Vater. „Natürlich siehst du nichts oder meinst du etwa, der Hirsch stellt sich für dich in Positur?“
„Hol mal unseren Klausi!“, rief Mutter dem Vater zu. „So was hat der bestimmt auch noch nich‘ gehört. Wieso schläft denn das Kind so fest? So einen Schlaf wie der möchte ich auch mal haben.“
Während nun Tante Ludmilla und Onkel Otto sehnsuchtsvoll Löcher in die Dunkelheit starrten, hatte Vater entdeckt, dass ich nicht in meinem Bett zu finden war. Da er unwahrscheinlich klug war, dämmerte ihm wohl, warum sich dieser Hirsch offenbar eine Tarnkappe übergezogen haben musste. Bei nach Lautstärke des Schreis zu urteilen hätte er gleich neben den Brombeerbüschen am Haus stehen müssen. Da war aber kein Hirsch zu sehen. Also musste es sich entweder um einen unsichtbaren Hirsch handeln oder um einen Miniatur-Hirsch mit einer furchtbar großen Klappe…
Grinsend kam mein Vater im Schlafanzug aus dem Haus und schlich sich in die Richtung, aus der er den „Hirsch“ hörte.
Dann rief er vorsichtig und leise: „Klausi, komm her! Aber pass auf, dass dich niemand sieht!“
Leise kichernd schlich ich mich zu ihm hin.
Vater flüsterte: „Du, Tante Ludmilla hat alles geglaubt. Sag mal, woher hast du denn das Rohr, womit du geblasen hast?“
„Ein Rohr hatte ich doch nicht“, erwiderte ich. „Unsere alte, große Blech-Gießkanne tut’s doch auch oder?“
Vater wollte sich ausschütten vor Lachen. Das war so richtig ein Streich nach seinem Herzen.
„Das gibt’s doch nicht“, gluckste er vor sich hin. „Es klingt wirklich so echt, dass alle da drin es glauben. Sogar Mutter und Oma suchen vom Fenster aus immer noch den Hirsch, der ihrer Meinung nach genau hier im Garten stehen müsste!“
Dann nahm er meine Gießkanne.
„Lass mich man auch mal probieren. Da drinne ist es schon wieder so ruhig, dass wir sie ein wenig aufwecken sollten“, flüsterte er. Und dann trötete er ganz laut und dann noch einmal leiser und dann immer leiser, um denen im Hause die Illusion zu vermitteln, der Hirsch würde sich vom Haus entfernen. Als dann eine Weile später der letzte Abschiedsschrei des Platzhirsches ertönt war, ging sofort bei Tante Ludmilla und Onkel Otto das Licht an.
„Da letzte Schrei von dem Hirsche nu klang aba janz andert als da ondere von vorhin!“, rief Tante Ludmilla ängstlich und schüttelte ungläubig den Kopf.
„Na ja, vielleicht is‘ et en andara jewes’n oda a is eb’n noch jung oda da is’ im Stimmbruche. Ick hoff bloß, dat se nich noch dat Kämpfen anfang’n! Dann kriej’n wa nie Ruhe zum Schloofen.“, erklärte Onkel kategorisch, drehte sich um und schlief bald wieder ein.
Lachend gingen Papa und ich ins Haus zurück. Mutter klärten wir natürlich über das „Hirsch-Wunder“ auf. Aber Tante und Onkel fuhren vier Tage später nach Berlin zurück in dem Glau-ben, dass sie in einer Nacht zwei Hirsche im Garten gehört und auch noch beinahe hätten kämpfen sehen. Sie redeten die ganzen nächsten Tage von nichts Anderem mehr. Da brachten wir es einfach nicht übers Herz, ihnen die schöne Illusion zu nehmen, dass ein echter Harzer Rothirsch nahezu auf Befehl nur für sie gebrüllt hatte.
Lediglich Onkel war irgendwie nicht so ganz überzeugt, dass das alles so seine Richtigkeit hatte mit dem bestellten Hirsch.
Als er sich verabschiedete, drückte er mir ein Fünfmarkstück in die Hand und flüsterte mir zu: „Für erwiesene Dienste, wa, Klausi.“
aus: Geschichten eines Harzer Lausbuben (10. Kapitel)
Buch bestellen
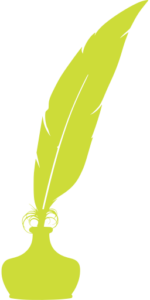 Sie wünschen sich ein Gedicht?
Sie wünschen sich ein Gedicht?